2024 ist kein Trockenjahr – im Gegenteil: Die Niederschläge fielen bisher stark wie lange nicht aus. Das fing bereits im Winter an und setzte sich übers Frühjahr und den Sommer fort. Für die Wälder ist das ein Lichtblick: Sie haben sich erholt.
Fakt ist: Auch dieser Sommer in Südbaden war nicht zu kalt, sondern um mehr als 2 Grad zu warm, allein der August war in Freiburg um 3,8 Grad wärmer als der langjährige Mittelwert. Aber: Es gab über einen längeren Zeitraum ausreichend Niederschläge, lediglich die letzten Augustwochen waren etwas zu trocken.
„Es ist wirklich sehr gut gewesen, dass es mal so viel geregnet hat. Durch den vergleichsweise feuchten Winter hatten die Bäumen schon einen guten Schub bekommen, hinzu kam dann noch, dass das Frühjahr nicht nur feucht, sondern auch realtiv kühl war, was Schadinsekten in ihrer Entwicklung hemmte“, erklärt Wissenschaftlerin Heike Puhlmann von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg.
Jedem dürfte zum Beispiel auffallen, dass die Rosskastanien in diesem Jahr deutlich weniger unter der Miniermotte leiden. Auch der Fichte gehe es etwas besser. „Doch der Klimatrend ist der Feind der Fichte. Deshalb wird man waldbaulich nicht mehr von der Prämisse abrücken, dass dieser Baum hier keine Zukunft mehr hat“, erläutert Puhlmann.
Nach Auskunft des Forstbezirks Hochschwarzwald erreicht der Käferschaden in den Gebieten Breisgau-Hochschwarzwald und Schwarzwald-Baar am meteorologischen Herbstanfang 13.500 Festmeter (Fm) Schadholz. Nach allen Erfahrungen bedeutet dies, dass am Jahresende mit rund 20.000 Fm Käferholz zu rechnen ist. Das ist immer noch viel, wäre aber eine deutliche Reduzierung im Vergleich zu den beiden Vorjahren, mit jeweils 37.000 und es wäre
der geringste Wert seit Beginn der Trockenjahre, die 2018 begannen.
Laut Heike Puhlmann waren die zurückliegenden Monate jedoch nur eine Verschnaufpause für den Wald. Weiterhin seien viele Bäume durch die Abfolge mehrerer Trockenjahre in Folge geschädigt. „Viele Buchen etwa sehen immer noch nicht gut aus. Wenn man genau hinschaut, sind die Kronen sehr durchlässig. Die Schädigungen liegen dann oft im Wurzelbereich. Selbst, wenn es mal ein feuchtes Jahr gibt, kann es passieren, dass die Bäume nach und nach absterben.“
„Alle Klimamodelle gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines heißen und dann oft trockenen Sommers zunimmt, gleichzeitig wird im Winter auch der für die Bodenfeuchtigkeit wichtige Schnee weniger. Auch Starkregenereignisse dürften sich häufen, doch die helfen dem Wald wenig, da der Boden diese Mengen nicht aufnehmen kann. Gleichzeitig haben sich jedoch die Vegetationsphasen der Bäume durch die Klimaveränderung erheblich ausgedehnt, dementsprechend brauchen sie auch mehr bzw. länger Wasser. Das heißt, die Wasserreserven in einem Wald sind früher aufgebraucht“, erläutert Heike Puhlmann. Bei Trockenheit werden Bäume anfällig, da durch das fehlende Wasser kaum Harzdruck aufkommt und somit gegen die unter der Rinde nistenden Borkenkäfer kaum Widerstandkraft vorhanden ist.
Es sei sinnvoll, den Wald weiter umzubauen, betont die Expertin. Ein klimastabiler Wald bestehe aus verschiedenen Baumarten, die mit dem Klima umgehen könnten. Insgesamt würden die Bestände in Zukunft sehr viel jünger und vielfältiger.
Für die Forstbetriebe gilt nach wie vor, möglichst effizientes Abholzen der stark Borkenkäferbefallenen Baumstämme und schnelle Abfuhr aus dem Wald, um zumindest den Befall neuer Bäume zu reduzieren. Klar ist, dass Fichten oder Tannen in niedrigeren oder besonders trockenen Lagen – wie etwa dem Sternwald oder an Südhängen – kaum noch geeignet sind. Wenn ein Waldbesitzer in Zukunft Nadelbäume haben will, sollte er an solchen Standorten zur Douglasie greifen, raten Experten. Wer lieber Laubbäume pflanzen möchte, wird Eichen und Buchen dazu mischen.
In der Forstwissenschaft gilt als Konsens, dass krisenfestere Wälder höhere Laubbaumanteile brauchen. Man sollte dabei nicht von vorneherein gebietsfremde Baumarten ausschließen. Dafür ist der Tieflagenwald am Rosskopf ein schönes Beispiel. Noch 1985 war die Fichte dort die häufigste Baumart. Seit damals sind Tanne, Buche und die nordamerikanische Douglasie an ihr vorbeigezogen. Mit geregelten Rehwildbeständen gelang dies ohne größere Pflanzmaßnahmen weitgehend durch Naturverjüngung.
Einige Baumarten, die besser mit Trockenheit und Hitze zurechtkommen, findet man beispielsweise in Nordamerika: Neben der erwähnten Douglasie sind dies beispielsweise Roteiche oder Zuckerahorn. Letztere beiden haben den Nebeneffekt, dass ihr Laub im Herbst farbenfroh leuchtet – man kennt das aus dem Indian Summer. Sicher ist: Der Wald wird sich verändern, aber er wird nicht verschwinden.
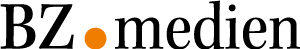

 Der Schwarzwald von oben: einige Gebiete haben sich erholt.
Foto: tobias
Der Schwarzwald von oben: einige Gebiete haben sich erholt.
Foto: tobias 

