Der Countdown zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025 läuft und der Wahlkampf nimmt immer mehr Fahrt auf. Michael Wehner, Leiter der Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung, spricht im Wochenbericht-Interview über die beherrschenden Themen im Wahlkampf, ob Kanzler Olaf Scholz überhaupt noch eine Chance hat und stellt sich der Frage, ob die politische Bildung in Deutschland versagt hat.
Wie beurteilen Sie als Politikwissenschaftler ganz generell die aktuelle Lage in Deutschland wenige Wochen vor der Bundestagswahl?
Michael Wehner: Dieser Wahlkampf wird kurz und heftig sein. Und er vollzieht sich vor dem Hintergrund eines Landes, das durch Krisen und Unsicherheiten derzeit nicht mehr so recht an sich selbst glauben mag. Es herrscht eine Unruhe, die mit Ängsten und Zukunftssorgen, auch im wirtschaftlichen Bereich, verbunden ist. Hinzu kommen die Entwicklungen in anderen Ländern wie etwa Österreich oder den USA, die zu der Verunsicherung beitragen.
Welche Themen werden über den Wahlausgang entscheiden?
Wehner: Der alte Clinton-Slogan „It’s the economy, stupid“ gilt in diesem Wahlkampf mehr denn je. Die anhaltende ökonomische Schwäche prägt die aktuelle Stimmung. Daher wird das Thema Wirtschaftspolitik eine übergeordnete Rolle spielen, wovon die Union profitieren könnte, der laut Umfragen am meisten wirtschaftliche Kompetenz zugeschrieben wird. Darüber hinaus werden auch die Themen Migration, die Zukunft der Europäischen Union, der Ukrainekrieg und weltpolitische Verunsicherungen eine Rolle spielen.
Beim Thema Migration scheint der Ton rauer geworden zu sein. Hat sich da etwas verschoben?
Wehner: Definitiv haben sich die Positionen nach rechts verschoben. In dem die anderen Parteien sich von der AfD treiben lassen, befördern sie das Thema weiter und helfen somit indirekt der AfD, die als einzige davon profitiert. (Restriktive) Migrationspolitik ist immer noch deren Alleinstellungsmerkmal.

Es wird oft behauptet, dass diese Wahl eine Richtungsentscheidung sei. Wenn man sich nun aber die Programme der etablierten Parteien anschaut, sind die Unterschiede eher nuancenhaft. Trifft es nicht vielmehr zu, dass es die letzte Chance für die demokratischen Parteien ist, das Ruder rumzureißen?
Wehner: Zumindest Stand heute ist davon auszugehen, dass es zu einer Großen Koalition von CDU/CSU und SPD, vielleicht auch zu Schwarz-Grün kommt, ansonsten sind die Koalitionsmöglichkeiten für die Parteien der Demokratischen Mitte sehr begrenzt. BSW und AfD sind auf Bundesebene auf keinen Fall koalitionsrelevant. Sie können allerdings Verhinderungsmacht bekommen, indem sie sehr stark abschneiden. In Österreich hat man gesehen, wie schnell ein Herbert Kickl nun Kanzler werden kann, dazu kommt die Rolle von meinungsmachenden Netzwerken wie X – all das deutet daraufhin, dass auch unsere Demokratie fragil ist. Daher stimmt es: Auf der kommenden Regierung lastet viel Druck, sie muss die wichtigsten Themen angehen und sollte liefern.
Trauen Sie das denn einer der beiden möglichen Koalitionen zu, das Ruder rumzureißen?
Wehner: Das wäre wünschenswert, aber letztlich ist das nur bedingt beeinflussbar, da weltpolitische Dinge ebenfalls eine große Rolle spielen – etwa, welches Porzellan Trump zerschlagen wird oder auch nicht, wie wird Putin agieren, was bedeutet das für die Militärausgaben, wie wird sich die Weltwirtschaft entwickeln etc. Und die Chancen für den ganz großen Neustart sind ebenfalls begrenzt, da eine Koalition immer aus Kompromissen besteht. Auch der Bundesrat muss in diese Kompromissfindung einbezogen werden und das BSW hat durch die Beteiligung an zwei Landesregierungen nun Mitsprachemöglichkeiten.
Die Unionsparteien dürfen nicht dem Fehler erliegen, zu glauben, das Rennen sei gelaufen. Öffentliche Patzer oder unglückliche Kommunikation können sehr schnell Dynamiken auslösen, die im Zeitalter Sozialer Medien nur schwer wieder einzufangen sind
Michael Wehner, Freiburger Politikwissenschaftler
Würden Sie sagen, dass der amtierende Kanzler Olaf Scholz, in Anbetracht der miserablen Umfragen überhaupt noch eine realistische Chance hat?
Wehner: Im Vergleich zu 2021 ist die Ausgangslage eine ganz andere und ja, es wird sehr schwer, diesen Rückstand noch irgendwie aufzuholen. Aber die Unionsparteien dürfen nicht dem Fehler erliegen, zu glauben, das Rennen sei gelaufen. Öffentliche Patzer oder unglückliche Kommunikation können sehr schnell Dynamiken auslösen, die im Zeitalter Sozialer Medien nur schwer wieder einzufangen sind. Daher kann in den kommenden vier Wochen durchaus noch einiges passieren und der Kanzlerkandidat der Union ist nicht viel beliebter.
Nicht nur in den Sozialen Medien geht es auffallend hitzig und unversöhnlich zu. Wie erklären Sie sich diese aggressive Stimmung?
Wehner: Es ist eine Gemengelage aus vielen Dingen. Angefangen bei Corona und seinen unaufgearbeiteten Folgen, über den Ukrainekrieg bis hin zum Klimawandel handelt es sich um Mega-Themen der Politik, die mit sehr unterschiedlichen Einstellungen verbunden sind. Das hat zur Folge, dass konträre oder differenziertere Meinungen nur schwer akzeptiert werden können. Insgesamt ist das Klima gereizter. Man spricht dabei auch von einer sogenannten Erregungsdemokratie. Das hat sicher auch mit den Sozialen Medien zu tun, Dinge rauszuhauen, ohne dass Fakten gegeben sind, und das alles meist nur in einer Echokammer mit Gleichgesinnten. In dieser ganzen Erregungsspirale wird man dann noch provokativer und tabubrechender und kommt gar nicht mehr auf die Idee, dass vielleicht auch der andere recht haben könnte. Das gefährdet unser bisher gewohntes Kompromissfindungsmodell.
Wenn nur noch Tiraden und schrille Thesen gehört werden und Fakten keine Rolle mehr spielen, hat dann beispielsweise der ruhige Erklärton eines Olaf Scholz überhaupt noch eine Wirkung?
Wehner: Vielleicht ist ein sachliche, zurückhaltende Moderation in einer übererregten Gesellschaft gerade notwendig. 2021 hat das ja mit einer Kopie des Merkel-Stils funktioniert, auch wenn die Dynamik sich seither verschärft hat. Aber natürlich ist es so, wenn gesellschaftliche Institutionen, wie etwa auch die klassischen Medien, weniger stark wahrgenommen werden und vieles nur noch in den Filterblasen stattfindet und Dreistigkeit immer öfter siegt, wird es schwierig, eine breite Öffentlichkeit nur mit Sachlichkeit zu erreichen.
Vor einigen Jahren schien die Zukunft noch Fridays for Future zu gehören, heute ist es nicht mehr Klimapolitik, sondern der Ruf nach Law and Order, Aufrüstung und einer gänzlich anderen Migrationspolitik, was die Debatten beherrscht. Einige Wahlprogramme erkennt man kaum mehr wieder. Was ist da los?
Wehner: Was wir gerade sehen, erscheint mir zum einen als Anpassung an realpolitische Zwänge und gesellschaftliche Strömungen. Es ist legitim, veränderten Rahmenbedingungen mit veränderten politischen Programmatiken zu begegnen. Aber natürlich verunsichert diese Disruption auch viele Wählerinnen und Wähler und sie wird von jenen befördert, die nach dem Prinzip „Provokation siegt“ handeln, also vor allem der AfD. Zum anderen ist der Zeitgeist, auch durch Protagonisten wie Trump und Putin, nationalistischer geworden.
Der Zeitgeist spielt der AfD ganz offenbar in die Karten.
Wehner: Es ist die Sehnsucht nach einfachen Lösungen und einer Verherrlichung einer Vergangenheit, in der die Probleme der Welt angeblich noch einfach zu lösen waren, in der alles steuerbar und kontrollierbar war und in der der Nationalstaat die Insel des Wohlstands bildete. Diese „Zukunft der Vergangenheit“ verspricht die AfD und natürlich speist sich ihr Erfolg aus dem gefühlten Kontrollverlust. Auch das BSW spielt mit der Sehnsucht nach einfachen Lösungen.
Wird die „Brandmauer“ auf Dauer aufrechtzuerhalten sein?
Wehner: Ja, die Brandmauer wird auf Bundesebene bis mindestens zur nächsten Bundestagswahl voraussichtlich 2029 halten, und auch auf Landesebene sehe ich bis zum Ende dieses Jahrzehnts kein Bundesland, in dem sich ein solches Szenario abzeichnet. Auf kommunaler Ebene könnte sich das anders entwickeln.
Laut Umfragen hadern die Bundesbürger so stark wie noch nie seit Gründung der BRD mit der Demokratie. Hat die Politische Bildung da nicht auch versagt?
Wehner: Natürlich ist es beunruhigend, wenn Institutionen in Frage gestellt werden und das auf Resonanz trifft. Aber wir brauchen in unserer Gesellschaft und in der politischen Bildung kritische Bürger, die Dinge hinterfragen und in Frage stellen. Demokratien brauchen aber auch das Vertrauen ihrer Bürger in ihre Problemlösefähigkeit. Interessanterweise war das Vertrauen in den Bundestag und in die Medien am höchsten während der Pandemie. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass auch bei dieser Bundestagswahl die Parteien der Mitte und nicht die Extreme mehrheitsfähig sein werden. Wie sich das in Zukunft entwickeln wird, wird sich zeigen. Ich kann mir aber unter keinen Umständen vorstellen, dass eine Mehrheit eine Abkehr von der Demokratie mit ihrer Vielfalt möchte und bereit ist, die eigenen Freiheitsrechte aufzugeben.
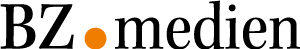

 Deutschlands politische Landschaft ist in diesem Wahlkampf von großer Unruhe geprägt. Foto: Imago / Daniel Lakomski / Jan Huebner
Deutschlands politische Landschaft ist in diesem Wahlkampf von großer Unruhe geprägt. Foto: Imago / Daniel Lakomski / Jan Huebner 

