Handys sind nützlich, können jedoch gerade in den Händen von Kindern zur Gefahr für selbige werden. Diskutiert wird daher ein landesweites Handyverbot an Schulen. Doch wie halten es Freiburger Schulen damit und was sagen Elternvertreter dazu?
Während das Droste-Hülshoff-Gymnasium früher eine lockere Regelung hatte, müssen Handys nun ausgeschaltet bleiben und dürfen nicht in Erscheinung treten, so Schulleiter Martin Rupp. Sowohl Lehrer als auch Schüler hätten zuvor festgestellt, dass sich die Kommunikation auf die mobilen Endgeräte verlagert hätte. „Das ist für die Stimmung nicht förderlich“, so Rupp. Er begrüßt daher ein landesweites Handyverbot an Schulen.
Cybermobbing als Problem
Carlos Santos-Nunier ist geschäftsführender Schulleiter der Sekundarstufe 2 und Schulleiter der Pestalozzi-Realschule. Hier gibt es für die Klassen 5 bis 8 „Handygaragen“, in denen Smartphones laut Hausordnung gesammelt werden. Wird ein Handy trotzdem heimlich genutzt, wird mit der Schülerin oder dem Schüler darüber diskutiert, warum er die Lehrer und andere betrüge, sagt Santos-Nunier. Im Unterricht werden wöchentlich zur Verfügung stehende IPads genutzt, Vertretungspläne und Stundenplan rufen die Kinder über eine App ab.
Jede Schule habe jedoch ihre eigene Regelung, so Santos-Nunier. Statt eines Handyverbots würde er eine einheitliche Regelung befürworten. Nur: „Die eine Lösung gibt es nicht“, weiß Santos-Nunier. Viele Eltern würden ständige Erreichbarkeit verlangen, wüssten aber kaum, was auf den Handys ihrer Kinder vorgeht. Schon in der Unterstufe nutzen Schüler Whatsapp, obwohl der Messenger-Dienst erst ab 13 Jahren freigegeben ist. Santos-Nunier möchte die Eltern verstärkt mit ins Boot holen. „Sie müssen sich Unterstützung holen, wenn sie Smartphones nicht verstehen.“
Dirk Baumgärtner ist Elternvertreter an der Pestalozzi-Realschule und Vater eines fast 13-jährigen Sohnes. Auch er sieht ein Handyverbot oder derzeit die Handygaragen in der Schule grundsätzlich positiv. Auch für seinen Sohn sei es okay, während der Schule keinen Zugriff auf das Handy zu haben. Die Eltern mehr einzubinden, würde er begrüßen – zum Beispiel in Form eines Infotages. Er selbst geht davon aus, über den Medienkonsum seines Sohnes gut informiert zu sein und pflegt einen lockeren Umgang. „Mein Sohn ist in seiner Freizeit viel unterwegs und wenn er abends ein bisschen Minecraft zockt oder sich Videos anschaut, ist das kein Problem.“ Er würde sich wünschen, dass Kinder das Internet mehr zur Wissensaneignung nutzen würden, statt für soziale Medien wie TikTok und Instagram.
Ab kommendem Schuljahr wird das Fach „IT- und Medienbildung“ neben den bereits existierenden Präventionsprogrammen neu eingeführt. „Uns muss klar sein, dass zu Prävention nicht nur Drogen und Rauchen gehören, sondern auch der sinnvolle Mediengebrauch“, sagt Rupp. Er bittet in der Unterstufe darum, keine Klassenchats zu erstellen. Wird das nicht befolgt, „folgen die Probleme auf dem Fuß“, so Rupp. Die Rede ist von Cybermobbing: Beleidigungen bis hin zu „Bildern, die in solchen Chats nichts zu suchen haben“, sagt Rupp. Diese Probleme sieht auch Carlos Santos-Nunier: „Cybermobbing findet vor allem am Nachmittag statt, es belastet aber die Schule und diese soll es dann richten“, sagt er. „Man macht sich Illusionen, wenn man denkt, man könne Zehn- oder Elfjährigen so etwas ohne unschöne Konsequenzen in die Hand geben“, so auch Rupp.
Kinder aufklären und nicht allein lassen
Leonie Schollän von der Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg der Aktion Jugendschutz sieht das Thema differenziert. Ein pauschales Verbot hält sie für nicht sinnvoll, befürwortet jedoch transparente Regeln. Im Unterricht seien Handys oft attraktiver als Lerninhalte, können aber sinnvoll integriert und die Medienkompetenzen so ausgebaut werden. „Kinder haben neben dem Recht auf Schutz auch ein Recht darauf, dass wir sie dazu befähigen, in einer digitalen Gesellschaft klar zu kommen.“
Hoher Medienkonsum sei nicht pauschal schädlich, es gehe um die genutzten Funktionen. Der Faktor Zeit sei nicht aussagekräftig, sondern ob die Kinder ihren Entwicklungsaufgaben nachkommen, so Schollän. Falschinformationen und unrealistische Schönheitsideale seien Gefahren, während soziale Kontakte und Wissensaneignung positiv seien. „Es gilt, genau hinzuschauen, welches Bedürfnis hinter dem hohen Medienkonsum steht und ob er andere Dinge behindert“, so Schollän.
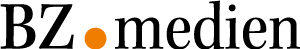

 Das Land Baden-Württemberg
diskutiert derzeit ein Handyverbot an Schulen. Foto: Adobe.Stock
Das Land Baden-Württemberg
diskutiert derzeit ein Handyverbot an Schulen. Foto: Adobe.Stock 

