Kokain und das daraus hergestellte Crack fluten seit einigen Jahren den Schwarzmarkt. Dies ist auch in Freiburg der Fall. Benedikt Vogt von der Drogenhilfe Freiburg berichtet, wie dies die Szene in verändert und wie die Suchtplätze die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit prägen.
Wie hat sich die Drogenszene in Freiburg in den letzten Jahrzehnten gewandelt?
Vogt: Eine Drogenszene ist nie eine homogene Gruppe. manche Untergruppe verschwindet aus dem öffentlichen Geschehen, andere tauchen auf. Gleichzeitig wechseln die dominante Substanzen alle paar Jahre aufgrund von Verfügbarkeiten und Reinheitsgehalten.
Seit etwa zwei Jahren ist sehr reines Kokain zu relativ günstigen Preisen auf dem Schwarzmarkt angekommen, dadurch wird aktuell überwiegend Kokain und das daraus hergestellte Crack konsumiert, was eine sichtbare Verelendung, mehr psychische Auffälligkeiten, einen merklich lauteren Szene-Alltag und gesteigerte Aggressivität mit sich bringt.
In den USA gibt es eine Opiod-Krise. Gibt es auch freiburgspezifische Drogen?
Vogt: Jede Szene hat sozusagen ihren eigenen Geschmack, es kommt immer wieder vor, dass in Freiburg eine Substanz stark konsumiert wird, die in Lörrach und Offenburg keine Rolle spielt. Aktuell wird vor allem Kokain und Crack, aber auch Heroin, Benzodiazepine und Ritalin konsumiert.

Benedikt Vogt, Leiter der Drogenhilfe Freiburg. Foto: AWO Drogenhilfe
Wie kommen Menschen in Kontakt mit diesen Substanzen und wer entwickelt letztendlich eine Abhängigkeit?
Vogt: Hierzu gibt es keine allgemeingültige Antwort. Manche Drogenkonsumierende sind bereits Kinder oder sogar Enkel von suchterkrankten Menschen. Manche sind über den Freundeskreis zu Kokain oder Speed gekommen und haben Heroin als Gegenmittel gegen die Kokain-typischen Depressionen am Morgen nach dem Konsum genutzt. Im Falle von schwer suchterkrankten Menschen spielen fast immer Traumatisierungen in Kindheit oder Jugend eine erhebliche Rolle, der Konsum illegalisierter Substanzen ist hier oft eine Art der Selbstmedikation.
Welchen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung von Suchterkrankten hat der Drogenkonsumraum geleistet?
Vogt: Rund 7.000 Konsumvorgänge wurden nicht in der Öffentlichkeit getätigt und der Müll sachgerecht entsorgt und lag nicht in der Öffentlichkeit rum. Außerdem konnten die konsumierenden Menschen sich in den Räumlichkeiten des Kontaktladens ausruhen und nahmen nicht stark sediert oder psychotisch am öffentlichen Leben teil. Und durch die etwa 700 im Konsumraum getätigten Wundversorgungen wurden viele schlechte Wundverläufe vermieden.
Hatte die Cannabis-Legalisierung Auswirkungen auf ihre Arbeit?
Vogt: Im niederschwelligen Bereich Kontaktladen und Konsumraum gab es kaum Änderungen, die Klientel dort lebt sowieso in der täglichen Illegalität. In der DROBS (Drogenberatungsstelle, Anm. d. Redaktion) hingegen sind die gerichtlichen Zuweisungen und generell juristischen Probleme für vor allem junge Cannabis-Konsumierende verschwunden, die Kontaktaufnahme dort erfolgt seitdem eher auf Eigeninitiative oder auf Druck vom Elternhaus.
Wie können Sie Suchtkranken helfen und welche Angebote gibt es?
Vogt: Wir bieten Safer-Use-Beratung und klinisch steriles Spritzbestecks zur Vermeidung von Infektionen mit HIV und Hepatitis C. Aber auch Wundversorgung, Vermittlung in Entgiftung und Therapie und eine Schuldnerberatung bieten wir an. Wir helfen bei der Beantragung von Sozialleistunen und bieten bald auch eine ambulante Gesprächstherapie sowie Erste-Hilfe-Schulungen im Fall eines Drogennotfalls.
Wie hoch ist der Anteil Minderjähriger an Ihren Klienten?
Vogt: In Kontaktladen und Konsumraum ist er rein rechtlich null Prozent. Da im Kontaktladen geraucht wird greift hier das Jugendschutzgesetz. Den Konsumraum dürfen rechtlich Minderjährige nur mit schriftlicher Erlaubnis der Eltern nutzen, dieser Fall ist bislang nicht eingetreten. In der DROBS liegt ihr Anteil bei etwa 8 Prozent, wobei dieser vor zwei Jahren noch deutlich höher war. Zu der Zeit war eine große Gruppe minderjähriger Opioid-Konsumierender in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Diese Gruppe hat nun in weiten Teilen die Volljährigkeit erreicht.
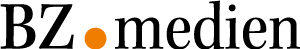

 Der Drogenkonsumraum am Colombipark. Foto: Michael Bamberger
Der Drogenkonsumraum am Colombipark. Foto: Michael Bamberger 

